In der Meiji-Zeit (1868-1912) änderte sich das bis dahin in Japan vorherrschende Frauenbild und Mädchenbildung war auf dem Vormarsch. Galten Frauen in der vorangegangenen Edo-Zeit noch als minderwertig, geriet in der Meiji-Zeit ihre Rolle als Staatsbürgerinnen in den Fokus, womit ihnen auch mehr Rechte zugesprochen werden sollten. Japan war auf dem Weg ein moderner Nationalstaat zu werden, und um intelligente Staatsbürger heranzuziehen, brauchte man „gute Ehefrauen und weise Mütter“ (ryōsai kenbo).
Die Rolle der Mutter als Pädagogin
Während der Meiji-Restauration befand sich Japan in einer Phase des Umbruchs und das Mädchen- und Frauenbild wandelte sich grundlegend. Das ryōsai kenbo-Ideal, welches in dieser Zeit entstand, sah Frauen dem Staat gegenüber in der Pflicht, ihre Rolle als Mütter und Ehefrauen gewissenhaft auszuüben und ihre Kinder als „Lehrerin“ liebevoll und weise anzuleiten. Diese Idee der Mutter als Pädagogin unterschied sich signifikant von der noch in der Edo-Zeit verbreiteten Ansicht, dass Frauen den Männern grundsätzlich intellektuell unterlegen seien und ihre Kinder dermaßen mit Liebe überschütteten, dass dies für deren Erziehung eher schädlich sei. Von Frauen wurde dementsprechend nur erwartet, gute Ehefrauen (ryōsai) zu sein, während sie von der Kindererziehung möglichst die Finger lassen sollten.
Das ryōsai kenbo-Ideal ist also ein Konzept der Moderne und war für damalige Verhältnisse durchaus fortschrittlich, auch wenn es aus heutiger Sicht nicht so erscheinen mag. Doch wer steckte eigentlich dahinter? Es waren in erster Linie die Intellektuellen, die sich während der Meiji-Zeit der Aufklärung verschrieben hatten und dieses Konzept voranbrachten. Einer der ersten war Mori Arinori, der sich für die Förderung von Mädchen durch Schulbildung einsetzte, um diese zu „weisen Müttern“ (kenbo) zu erziehen. Großen Einfluss hatten auch westliche Werke, die damals in großer Anzahl ins Japanische übersetzt wurden. Ein in Japan sehr bekannter westlicher Pädagoge, der die Rolle der Mutter in der Kindererziehung betonte, war beispielsweise der Schweizer Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827).

Mehr Bildung für Mädchen
Erst nach dem Ersten Sino-Japanischen Krieg (1894-95) führten diese neuen Theorien zu einer Reform des Schulsystems und der Besuch einer weiterführenden Schule nach Abschluss der Grundschule wurde auch für Mädchen erstrebenswert und vor allem möglich, da nun zahlreiche neue Mittelschulen gebaut wurden. Die erste staatliche weiterführende Mädchenschule Tōkyō joshi shihan gakkō (heute: Ochanomizu Daigaku) entstand bereits 1875, doch erst 1899 wurden weiterführende Schulen für Mädchen gesetzlich anerkannt und etablierten sich als Bildungsinstitute.
Das ryōsai kenbo-Konzept war Teil der staatlichen Ideologie, denn man ging davon aus, dass weiterführende Bildung für Frauen zum Wohlsein und zur Stärke der Nation beitrage. Dies hieß aber noch lange nicht, dass sie den Männern gleichgestellt waren. Der Schulbesuch diente lediglich dazu, ihnen eine Grundbildung zu ermöglichen, die sie befähigte, ihre Kinder „weise“ anzuleiten, den Haushalt zu führen und ihren Ehemännern als Ratgeberinnen zur Seite zu stehen. Dieser moderne Ansatz wurde jedoch noch nicht an allen Schulen gleichermaßen gelehrt, sondern vielerorts noch der Fokus auf die Edo-zeitlichen „weiblichen“ Tugenden wie „Gehorsam“ und „Bescheidenheit“ gelegt. An manchen Schulen war es den Schülerinnen sogar verboten Zeitung zu lesen.

Erste Schritte in Richtung Emanzipation
Anfang des 20. Jahrhunderts änderte sich die Sichtweise auf Frauen allmählich und das ryōsai kenbo-Konzept geriet immer mehr in die Kritik. Zwischen 1910 und 1920 stieg die Anzahl der Mädchen, die eine weiterführende Schule besuchten, rasant an – eine Entwicklung, die in den folgenden Jahren weiter an Fahrt aufnahm. Da es immer mehr gebildete Frauen gab, entstand auch eine Reihe von Frauenmagazinen für diese Zielgruppe und parallel zur Suffragettenbewegung im Westen traten in Japan die ersten Feministinnen auf den Plan. Man war in der Taishō-Zeit (1912-1926) angekommen, die auch einen neuen Modebegriff mit sich brachte: shokugyō fujin, womit Frauen gemeint waren, die Berufe wie Büroangestellte, Lehrerin, Typistin oder Krankenschwester ausübten. Die Industrialisierung eröffnete neue Berufsfelder und damit auch andere Lebenswege als bisher.
Zwei der bekanntesten Feministinnen, die Kritik am ryōsai kenbo-Gedanken übten, waren Hiratsuka Raichō und Yosano Akiko, die jeweils unterschiedliche Ideen hatten, wie Frauen mehr Freiheit und Rechte erlangen könnten. Yosano ging davon aus, dass Frauen als Menschen den Männern gleichgestellt sein sollten. Sie warb dafür, dass Frauen sich durch Erwerbstätigkeit auch in der Ehe ihre Unabhängigkeit bewahren sollten und so beide Ehepartner mehr Freizeit hätten, da sie sich die Arbeit teilen könnten. So entstünde eine gleichberechtige, auf Liebe basierende Partnerschaft. Hiratsuka dagegen betonte die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und plädierte dafür, dass Mütter eine staatliche Entschädigung erhalten sollten, um sich ihren Erziehungsaufgaben widmen zu können, ohne ihre finanzielle Unabhängigkeit zu verlieren.

Yosanos und Hiratsukas Ansichten in Bezug auf die Rolle der Frau waren also das genaue Gegenteil voneinander. Während Yosano es als entscheidend betrachtete, dass Frauen die bislang männliche Domäne der Erwerbstätigkeit eroberten, sah Hiratsuka, dem ryōsai kenbo-Gedanken entsprechend, Mutterschaft und Kindererziehung als Hauptaufgabe der Frauen an, die aber finanziell entlohnt werden sollte. Yosanos Ansatz war hier wesentlich radikaler, denn sie sah die traditionelle Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau nicht, wie die ryōsai kenbo-Ideologie es vorgab, als naturgegeben an.
Ein neues ryōsai kenbo-Konzept?
Nicht nur Feministinnen, sondern auch männliche Politiker und Pädagogen der Taishō-Zeit waren der Ansicht, dass es Zeit für ein neues ryōsai kenbo-Konzept war. Vor allem vor dem Hintergrund, dass vielerorts noch die Edo-zeitlichen weiblichen Tugenden gelehrt wurden, die auf den sog. Onna daigaku-Schriften basierten, Lesebüchern für Mädchen, die u. a. moralische Verhaltensanleitungen enthielten und als nicht mehr zeitgemäß empfunden wurden. Außerdem hatte der Erste Weltkrieg gezeigt, dass Frauen durchaus in der Lage waren, aktiv mit anzupacken, wenn es nötig war.
Hierzu gab es zwei Ansichten: Eine Minderheit plädierte dafür, dass Frauen nur bis zur Heirat arbeiten sollten, während eine größere Gruppe Pädagogen durchaus auch die Arbeit in der Ehe unterstützte. Unter „Arbeit“ wurden hier entweder Tätigkeiten verstanden, die auch zu Hause ausgeführt werden konnten, wie Handarbeit, Hühnerzucht und Obstanbau oder aber eine Anstellung außerhalb des Hauses. Man ging davon aus, dass diese Tätigkeiten nicht im Konflikt mit der Rolle als „guter Ehefrau und weiser Mutter“ stünden, sondern vielmehr einen positiven Effekt auf die Arbeitsmoral hätten und für den Nationalstaat ein Gewinn wären.
Außerdem wurde im Parlament immer häufiger die Notwendigkeit der höheren Bildung für Frauen diskutiert. Die Zahl der beruflich orientierten privaten Hochschulen für Frauen stieg zwar ab den 1920er Jahren an, doch an Universitäten wurden Frauen nur in Ausnahmefällen zugelassen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnten sie sich offiziell immatrikulieren lassen.
Die ryōsai kenbo-Ideologie nach dem Zweiten Weltkrieg
Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich einiges für die Frauen in Japan. Rechte, für die sie bisher gekämpft hatten, wie den Eintritt an die Universität oder das Wahlrecht, wurden ihnen endlich zugestanden. Die ryōsai kenbo-Ideologie überlebte den Krieg und hat sogar bis heute Einfluss auf das Frauenbild, wenn auch in abgewandelter Form. Die Erziehungswissenschaftlerin Koyama Shizuko argumentiert, dies läge daran, dass die Trennung zwischen Reproduktion und Produktion bzw. die Entstehung „privater“ und „öffentlicher“ Bereiche (mit der traditionellen Arbeitsaufteilung zwischen Mann und Frau) die Basis sei, auf der sich der moderne Nationalstaat begründet.
Seit 1947 gibt es in Japan gemischte Schulen und Universitäten und auch Mädchen absolvieren in der Regel mindestens die Oberschule. Gleichzeitig wirkt das ryōsai kenbo-Ideal bis heute nach, denn auch wenn es vereinzelt Väter gibt, die sich intensiv der Kindererziehung widmen, sind es doch größtenteils noch die Frauen, denen diese Aufgabe zufällt. So kam in den 1960er Jahren sogar ein neuer Begriff für Mütter auf, die ihre Kinder durch das komplizierte japanische Prüfungssystem bis zur Universität drillen: kyōiku mama („Bildungsmama“). Bis in die späten 1980er Jahre wurde das dahinterstehende Familienmodell mit dem Mann als Hauptverdiener kaum infrage gestellt, doch sorgte die in den 1970er Jahren erstarkte Frauenbewegung allmählich dafür, dass junge Frauen sich dieser Norm nicht mehr anpassen wollten.
Sinkende Geburtenrate in Japan
Bereits 1993 war die Geburtenrate bei Frauen im gebärfähigen Alter auf 1,46 gesunken, ein Trend, der sich seitdem unaufhaltsam fortgesetzt hat (2020 lag sie bei etwa 1,34). Hierfür wurde das höhere Bildungsniveau der Frauen verantwortlich gemacht, die immer häufiger die Universität besuchten, was sie angeblich von ihren „häuslichen Pflichten“ ablenkte, wie der damalige Finanzminister Hashimoto Ryūtarō 1990 anmerkte. Wie der Ostasienwissenschaftler Tony Dickensheets im Magazin Japan Quarterly feststellt, entsprach diese Sichtweise der allgemeingesellschaftlichen Haltung zu der Zeit. Tatsache ist, dass es in Japan nach wie vor sehr schwierig ist, Beruf und Kindererziehung miteinander zu vereinen, da es oft an Betreuungsmöglichkeiten fehlt und von Arbeitnehmern i.d.R. erwartet wird, sich mit Leib und Seele dem Arbeitsplatz zu verschreiben. Daher bleibt den Frauen meist nichts anderes übrig, als sich zwischen Karriere und Kindern zu entscheiden: Die niedrige Geburtenrate ist eine natürliche Folge davon.
Yosano Akikos Forderung nach Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen ist heute aktueller denn je. Auch wenn das ryōsai kenbo-Konzept heute nicht mehr als Staatsideologie propagiert wird, wirkt es doch heimlich im Hintergrund weiter, wohl ohne dass sich die meisten dessen bewusst sind.
Quellen
- Dickensheets, Tony: “The Role of the Education Mama”. In: Japan Quarterly; Tokyo Bd. 43,Ausg. 3, (01.07.1996): 73.
- Koyama, Shizuko (2013): Ryōsai kenbo. The educational ideal of “good wife, wise mother” in modern Japan. Leiden: Brill.
- https://www.heinrich-pestalozzi.de/grundgedanken/erziehung-bildung
Bildnachweise
- Mutter mit Kind auf dem Arm, ca. 1969: © さのふみこさん / Photo AC. Abgerufen unter: https://www.photo-ac.com/main/detail/22903677#goog_rewarded
- Mutter und Kind, ca. 1870-79: The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Collection, The New York Public Library. (1870 – 1879). Mother and child. Abgerufen unter: https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-c58d-a3d9-e040-e00a18064a99
- Schülerinnen der Tōkyō joshi shihan gakkō, ca. 1917-1921: Mit freundlicher Unterstützung der Ochanomizu-Universität. © Ochanomizu University.
- Foto Yosano Akiko: NDL Portraits of Modern Historical Figures. Abgerufen unter: https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/347
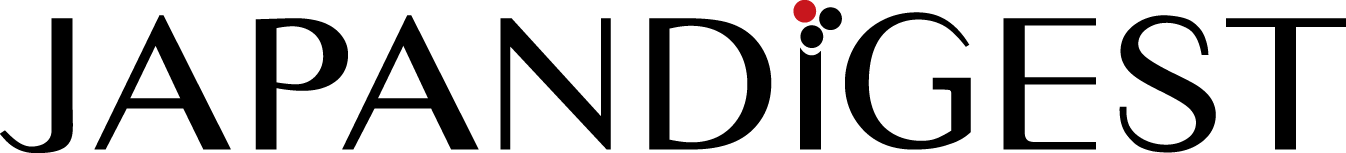




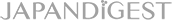
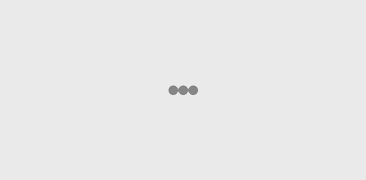




Kommentare