Es ist ein nationales Ereignis – und für Familien mit Kindern ein großer Moment, bei dem alle Angehörigen mitfiebern: Der daigaku nyūgaku kyōtsū tesuto, gern schlicht kyōte abgekürzt. Der offizielle Name lautet Common Test for University Admissions und er entscheidet maßgeblich darüber, an welcher Universität man nach der Oberschule studieren kann. Die Prüfung wird vom Nationalen Zentrum für Universitätseingangsprüfungen, dem DNC, erstellt und verwaltet. Die Organisation wird zwar als unabhängig bezeichnet, steht aber unter der Kontrolle des japanischen Bildungsministeriums.
Das System ist vergleichsweise kompliziert. In Japan gibt es mehr als 800 Universitäten. 185 dieser Unis sind öffentlich, d. h., die Studiengebühren sind gedeckelt und nicht ganz so teuer wie an privaten Unis. Dazu kommt ein knallhartes Ranking bei den Universitäten – je höher der Rang, desto einfacher wird es für die Absolventen, später eine gute bzw. gutbezahlte Arbeit zu finden.
Kompliziertes Testsystem
Nicht alle Universitäten nehmen am Testsystem teil, doch viele tun es. Diese machen dann die Teilnahme an der eigentlichen hauseigenen Aufnahmeprüfung vom Testergebnis abhängig. An rund 650 verschiedenen Orten in ganz Japan finden die Prüfungen statt. Die Geprüften dürfen die Aufgaben anschließend mit nach Hause nehmen – und das müssen sie auch, denn die Testergebnisse erfahren sie bis Mitte April nicht. Stattdessen müssen sie selbst zu Hause oder an Schulen anhand der Aufgaben und des eigenen Gedächtnisses nachvollziehen, wie viele Punkte sie geschafft haben. Im Jahr 2025 lag die maximale Punktzahl bei 1000 Punkten. Die Ergebnisse werden mit Computern ausgewertet und an die teilnehmenden Unis verschickt – diese bestimmen dann anhand der statistischen Verteilung der Ergebnisse, wo sie die Grenzen für Bewerber:innen setzen. Eine gute Universität kann dann zum Beispiel festlegen, wo die Untergrenze der besten 2 % liegt und dies als Grenze bestimmen. Haben zum Beispiel 2 % der Geprüften mehr als 870 Punkte, dann dürfen nur die mit 870 Punkten und mehr an der eigentlichen Prüfung teilnehmen – der Rest muss sich mit einer anderen Uni begnügen.
Dieser ashikiri, wörtlich “Füße abschneiden”, genannte Prozess sorgt dafür, dass sich nahezu alle 18-Jährigen an mehreren Unis bewerben, um letztendlich an einer Uni angenommen zu werden. Hier hat der Test jedoch auch seine positiven Seiten: Manche Unis akzeptieren Bewerber:innen nur anhand des kyōte-Ergebnisses – man braucht keine weiteren Prüfungen zu durchlaufen. Außerdem wird das Testergebnis von vielen Unis in die Endbewertung einbezogen: Wer also ein sehr gutes Ergebnis hatte, hat bei der eigentlichen Aufnahmeprüfung bereits einen spürbaren Vorteil. Die Obergrenzen sind nicht nur je nach Universität verschieden, sondern auch je nach Fakultät.
Einfluss des demografischen Wandels
Die Prüfungen haben es in sich: Hier wird weit mehr als der normale Lehrstoff abgefragt, und das in bis zu 10 verschiedenen Fächern. Dabei kann man jedoch wählen zwischen einer geisteswissenschaftlichen und einer naturwissenschaftlichen Ausrichtung. Vor allem private Unis interessieren sich in der Regel nur für drei oder vier Fächer, während öffentliche Unis oft an acht oder mehr interessiert sind. Der kyōte-Test ist so wichtig, dass sich die meisten Schüler:innen das gesamte Jahr davor vorbereiten. Doch das ist nicht aller Menschen Sache: Immer mehr Japaner:innen bevorzugen eine Universität, an die man mittels einer Empfehlung gelangt. So braucht man nicht für Aufnahmeprüfungen büffeln. Und da immer mehr Universitäten mit dem Problem sinkender Studierendenzahlen zu kämpfen haben – eine Folge der demografischen Entwicklung in Japan – gewinnt das Empfehlungsprinzip zunehmend an Bedeutung. Mit dem negativen Effekt, dass die Universitäten im landesweiten Ranking sinken.
Die kyōte-Prüfung – sowie der hohe Druck, der auf die Prüflinge lastet – ist keine japanische Besonderheit, sondern in ganz Ostasien verbreitet: In Südkorea ist die Prüfung unter dem Namen suneung bekannt, und in China fiebern jährlich viele Millionen junge Menschen dem gaokao entgegen. Ein Nebeneffekt von Gesellschaften, in denen Name und Prestige wichtiger sind als das eigentliche Studienfach. Frei nach dem Motto: Es ist nicht wichtig, dass oder was man studiert – sondern wo.
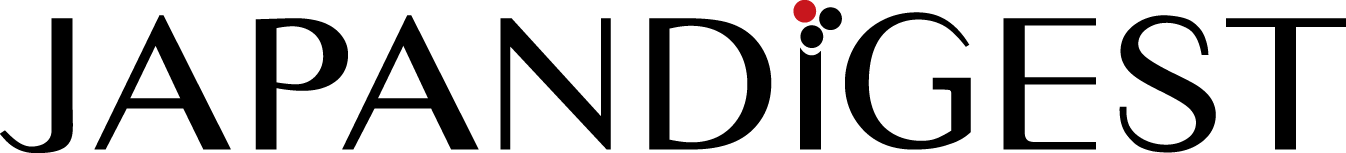




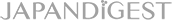

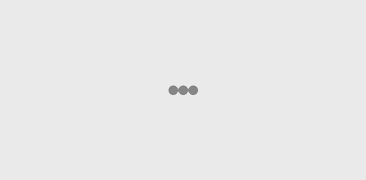




Kommentare