Reiche bleiben unter Reichen, Arme unter Armen. Um dieses Dilemma (ein Dilemma zwar „nur“ für die Armen, doch die sind ja vielerorts in der Überzahl), zu lösen, helfen nur gleiche Bildungschancen für alle. Soll heißen, alle Kinder sollten, unabhängig von den familiären Verhältnissen, gleichermaßen Zugang zu den verschiedenen Bildungsinstitutionen haben. Um so etwas zu regulieren, gibt es die reguläre Schulpflicht sowie später, falls nötig, Stipendien. Das ist auch in Japan nicht anders.
Bewertung einzelner Bildungsinstitutionen
Doch in Japan gibt es einen erheblichen Unterschied: Hier werden Oberschulen und Universitäten direkt untereinander verglichen. So gibt es „gute“ Schulen und Universitäten, und dementsprechend weniger gute. Und die Japaner wissen ganz genau, welche Universitäten im Land und welche Oberschulen in der Region gut sind und welche nicht. Dafür sorgt der hensachi-Wert 偏差値, der errechnet, wie weit die Institution – in beiden Richtungen – vom Standard abweicht (in der Statistik als Standardisierung bekannt). Dieser Wert wird von den privaten Nachhilfeschulen juku 塾 berechnet – anhand von Übungseintrittsprüfungen für die diversen Schulen. Die Genauigkeit ist damit nicht immer gegeben, denn je kleiner die Zahl Juku-Besucher einer gewissen Schule ist, desto weniger aussagekräftig ist der Wert.
Bei den Universitäten ist der Qualitätsunterschied relativ leicht zu erklären, denn da herrscht schon seit langem Wettbewerb – schließlich ist ein Großteil der japanischen Unis in privater Hand. Universitäten mit gutem Ruf müssen sich weniger darum sorgen, genügend zahlungskräftige „Kunden“, sprich Studenten, zusammenzubekommen. Auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, zum Beispiel durch das Sponsoring von Forschungskräften oder das Vermitteln der Studenten an die Unternehmen, klappt dort besser. Die Qualität der Studenten wiederum wird mittels mehr oder weniger rigider Eintrittsprüfungen geregelt. Aber sind die Eintrittsprüfungen zu Top-Universitäten wie der Universität Tōkyō 東京大学, kurz Tōdai, schlichtweg nur etwas für ganz Schlaue?
Förderung macht den Unterschied
Das Problem ist Folgendes: Sicher, es gibt angeborene Intelligenz. Doch wenn diese nicht entsprechend gefördert wird, hat man kaum eine Chance, die Eintrittsprüfungen zu einer Elite-Universität zu schaffen. Bei den Prüfungen wird in Japan nämlich schlichtweg trockenes Wissen abgefragt. Das bekommt man an guten Oberschulen vermittelt, an schlechten eher nicht.
Da auch bei Oberschulen schon mittels Eintrittsprüfung ausgesiebt wird, beginnt der Prozess der Elitisierung in der japanischen Bildung nicht selten im Vorschulalter. Vom Privatkindergarten geht es an eine Privatgrundschule und dann zur privaten Mittelschule. Praktischerweise bieten viele private Bildungsträger gleich alles im Paket an. Zu saftigen Preisen, versteht sich. Der Markt ist nämlich da.
So erklärt sich die große Bedeutung schulischer Bildung in Japan: Wenn es etwas Wichtiges im Lebenslauf gibt, das einem den Eintritt in den japanischen Arbeitsmarkt erleichtert, dann ist es der Name der Universität. Danach richtet sich, wo man arbeiten kann, wie viel man verdient, mit welchen Leuten man verkehrt – und sogar, wen man heiratet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Absolvent einer „Wald- und Wiesenuniversität“ später eine gut verdienende Tōdai-Abgängerin heiratet, ist verschwindend gering.
Da ist es kein Wunder, dass nicht wenige Japaner ein sogenanntes Rōnin-Jahr 浪人einlegen, wenn sie es nicht auf Anhieb in ihre Wunschuniversität geschafft haben. Mit dem Wort bezeichnete man im Japan der Feudalzeit ursprünglich herrenlose Samurai. Heute impliziert der Begriff, dass die Schulabgänger nochmal ein ganzes Jahr für die Eintrittsprüfungen pauken, denn nicht weniger als ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Dass der Großteil der Universitätsabsolventen ihr jeweiliges Studienfach später im Arbeitsleben nicht verwendet, ist dabei eine andere Geschichte.
Den Politikern in Japan ist die Problematik der Bildungsfalle durchaus bewusst, und es gibt zaghafte Versuche, dieser Problematik entgegenzuwirken – zum Beispiel damit, dass der hensachi-Koeffizient nicht mehr für Mittelstufen berechnet wird. Doch für Oberschulen zum Beispiel bleibt der Wert entscheidend und bestimmt so für viele Japaner, wie ihre Zukunft aussehen wird.
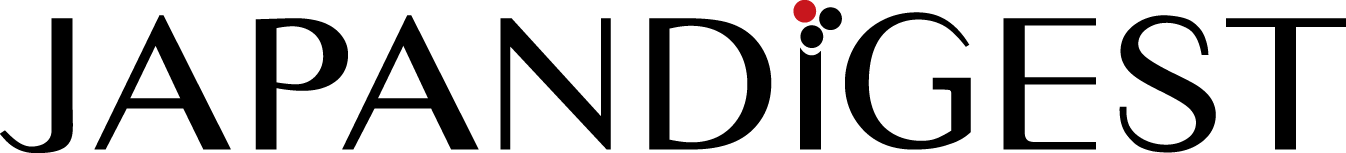



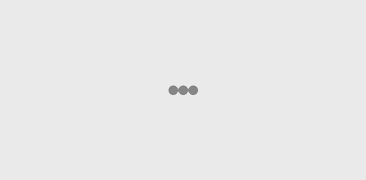




Kommentare