Wer durch die ländlichen Regionen Japans reist, stößt mitunter unvermittelt auf ein seltsames Schauspiel: monumentale, farbenprächtige Statuen aus Beton – ein Mönch in Predigerpose, ein Märchenheld mit Schwert, grimmige Dämonen oder Samurai in voller Rüstung. Diese Figuren sind keine Überbleibsel eines Freizeitparks oder Filmsets, sondern das Lebenswerk eines einzelnen Mannes: Asano Shōun (1891–1978). Ohne akademische Ausbildung, aber mit unbeirrbarem Willen und schier endloser Schaffenskraft hinterließ er über 800 Werke, die heute als einzigartige Mischung aus religiöser Volkskunst, naivem Realismus und skurrilem Humor gelten.
Vom Ton zum Beton
Geboren 1891 im Dorf Sakamoto (heute Nakatsugawa, Präfektur Gifu), stammte Asano Shōun aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater arbeitete in der Landwirtschaft und fertigte nebenbei traditionelle Tonfiguren an. Auch Asano begann mit der Herstellung solcher Figuren – doch seine künstlerischen Ambitionen reichten bald über das Kleinformat hinaus. Sein Wunsch: größere Werke schaffen. Und so wechselte er das Material – von Ton zu Beton. Mit 33 Jahren im Jahr 1924 zog er nach Nagoya und verdiente seinen Lebensunterhalt zunächst als Maler von Kinoplakaten. Parallel dazu entwickelte er seine eigene Technik zur Herstellung von Betonfiguren, ganz ohne formale Ausbildung – nur durch Übung, Neugier und Beharrlichkeit.
Über 800 Skulpturen – Volkskunst mit Charakter
Seine Werke stellen buddhistische Figuren oder historische Persönlichkeiten dar, meist in Lebensgröße oder sogar darüber hinaus. Ihre Zahl beläuft sich auf mindestens etwa 800. Viele befinden sich konzentriert an einem Ort – in Tempelanlagen, Themenparks oder Freiluftmuseen. In technischer Hinsicht wirken die Werke manchmal unbeholfen, doch gerade das verleiht ihnen einen einzigartigen Charme. Ihr unverkennbarer Stil zieht noch heute Fans in ihren Bann. Ein gewaltiges Lebenswerk, das trotz (oder gerade wegen) seiner Exzentrik als ein Stück japanischer Alltagskunst gilt.
Eine Spurensuche: Der Mann hinter dem Beton
Über Asano Shōuns Leben war lange Zeit nur wenig bekannt. Der Journalist und Autor Ōtake Toshiyuki, der sich ab den 2000er-Jahren intensiv mit Asanos Werk beschäftigte, schildert die mühsame Recherche: Nur der Nachname war überliefert. Mit Hilfe eines Telefonbuchs rief er sämtliche „Asano“-Haushalte der Region an – und fand schließlich die beiden Töchter des Künstlers.
Durch ihre Erzählungen wurde klar: Der Künstler war ein äußerst sturer, handwerksorientierter Mensch – einer, der seiner eigenen Vorstellung treu blieb und zeitlebens keine Kompromisse machte. Er glaubte an seine Kunst und wich bis zuletzt nicht von seiner Vision ab, ganz gleich, wie sehr sie dem Mainstream widersprach. 2009 wurde im Goshikien-Park in Nisshin (Präfektur Aichi) ein Restaurierungsprojekt ins Leben gerufen. Ziel: die Erhaltung und Pflege der dortigen Asano-Figuren. Mittlerweile erfährt das Werk Asanos auch international Beachtung – als außergewöhnlicher Ausdruck von Volksglauben und populärer Ästhetik im Japan des 20. Jahrhunderts.
Momotarō-Schrein (Momotarō-Park), Inuyama, Aichi




Goshikien (Nisshin, Aichi)




Sekigahara War Land (Sekigahara, Gifu)





Militärfiguren in Nakanoin (Minamichita, Aichi)



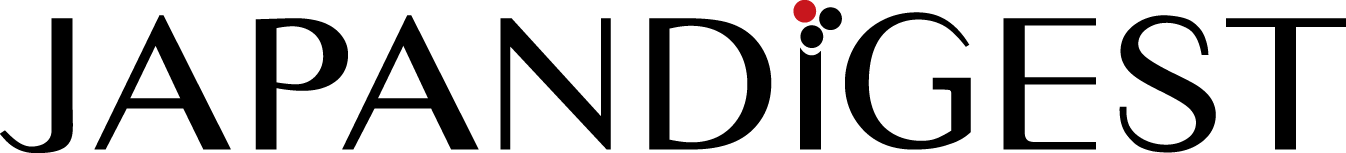




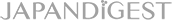
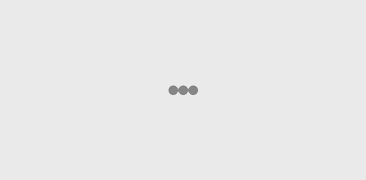




Kommentare