Man muss sich nur in ein x-beliebiges Restaurant oder in eine Bar begeben, die noch nicht sehr alt sind – sehr schnell merkt man dort, wie viel Liebe zum Detail bei der Innenausstattung gesteckt wurde. Die Handwerkskunst blüht in Japan, die Qualität ist in der Regel hervorragend, und dasselbe gilt auch für die traditionellen Kunstformen wie das Töpferhandwerk, die Gastronomie und mehr. Dahinter steckt ein Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende altes Meister-Gesellen-System.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre – diese alte Weisheit gilt auch und erst recht in Japan, wo die vertikale Hierarchie in Gruppen noch eine große Rolle spielt: Das wird schon beim Begriff für Lehrer, sensei, klar: “der/die zuerst Geborene”. Und das hat System, sowohl beim Handwerk als auch in Kunstformen, als auch in der Küche. Wer sich nach der Schule für einen bestimmten Berufszweig oder eine bestimmte Kunstform interessiert, macht sich deshalb auf die Suche nach einem geeigneten suishō, einem Meister des jeweiligen Fachs. Stimmt die Chemie, entsteht daraus – durch eine mündliche Abmachung – ein Meister-Gesellen-Verhältnis. Damit wird man als Aspirant zum sogenannten deshi, ein Wort, das sich aus den Schriftzeichen für “jüngerer Bruder” und “Kind” zusammensetzt.
Ein harter Job, der Hingebung erfordert
Auch in den Sportarten entsteht oft diese Art der Abhängigkeit, doch wer sich darauf einlässt, sollte genau wissen, was in den folgenden Jahren passieren wird. Denn die Rolle des Lehrlings legt man nicht einfach beim Verlassen der Fabrik, Werkstatt oder des Trainingsraums ab: Dieses Abhängigkeitsverhältnis geht meistens weit darüber hinaus und reicht bis ins Privatleben. Die ersten Jahre sind in der Regel besonders hart, wird man doch in dieser Zeit fast nur mit allen möglichen kleineren Aufgaben betraut: Im Sushi-Restaurant wären dies Dinge wie Abwaschen, Putzen, nach zwei bis drei Jahren vielleicht Reis waschen, Speisen frittieren und so weiter. Bis man wirklich die kleinen Leckerbissen selbst zubereiten und kredenzen darf, gehen durchaus schon mal zehn Jahre ins Land – harte Jahre unbedingten Gehorsams, die sehr viel Geduld erfordern. Deshalb ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Hälfte der Sushi-Koch-Anwärter:innen nach im Schnitt einem Jahr den Reislöffel hinwerfen.
Ein aussterbendes System
Nicht selten werden die „Gesellen“ aus der eigenen Familie rekrutiert – auch das ist sowohl im Gewerbe als auch in der Kunst, etwa bei vielen traditionellen darstellenden Künsten wie Nō oder Rakugo, der Fall. Familie hin oder her – im Prinzip dominiert die Lehrling-Meister-Beziehung, und die bleibt bis zum Lebensende bestehen. Das System sorgt dafür, dass hier wichtige Traditionen über Generationen weitergegeben werden, und dazu gehört unter anderem eine unglaubliche Liebe zum Detail. Leider mutet das in der heutigen Zeit als anachronistisch an: In einer so schnelllebigen Ära sind immer weniger Japaner:innen geduldig genug, um das viele Jahre andauernde Training durchzuhalten.
Die Sushi-Branche ist ein gutes Beispiel dafür: In jüngster Zeit gibt es Projekte, bei denen gestandene Angestellte in ihrer Freizeit lernen, ordentliches Sushi zuzubereiten. Das Erlernen der Fähigkeiten geschieht dabei vor den Augen der Gäste und in stark verkürzter Form. Das hat seine Vor- und Nachteile, doch einen anderen Weg scheint es nicht mehr zu geben. Denn wenn sich niemand findet, der den Betrieb weiterführen kann oder will – in der stark alternden japanischen Gesellschaft mit einer chronisch niedrigen Geburtenrate ein immer dringender werdendes Problem – gibt es nur zwei Möglichkeiten: Den Betrieb beziehungsweise das Restaurant schließen, oder eben alternative Methoden finden. In den Kunst- und Theaterformen ist das Meister-Gesellen-System noch sehr verbreitet und äußerst wichtig – im Handwerk sowie in der Gastronomie verliert es jedoch zwangsläufig nach und nach an Bedeutung.
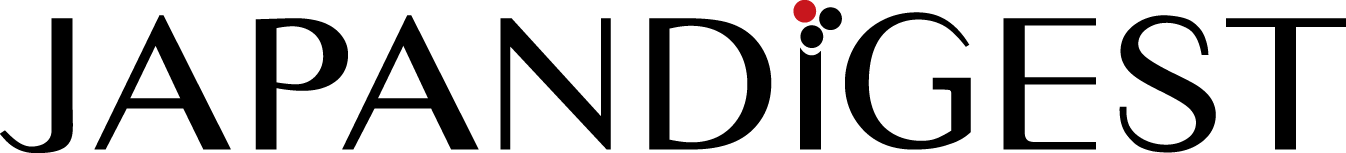




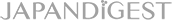

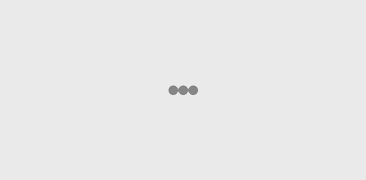




Kommentare